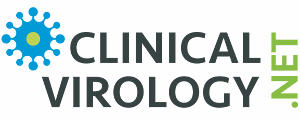Wie lassen sich Infektionsdaten sinnvoll bündeln, auswerten und für Forschung und öffentliche Gesundheit nutzbar machen? Diese Frage stand am Anfang des Clinical Virology Network (CVN) – einer Initiative, die Laborinformationen aus ganz Deutschland (und darüber hinaus) zusammenführt.
Im Gespräch erklärt Prof. Dr. med. Barbara Gärtner vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität des Saarlandes, wie das Netzwerk entstand, welche Lücken es in der Surveillance schließt, und warum ehrenamtliches Engagement und wissenschaftliche Kooperation dabei entscheidend sind.
CVN: Was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich im Clinical Virology Network zu engagieren?
Prof. Gärtner: Wir hatten in einem Kreis von Kolleginnen und Kollegen aus der Virologie aus verschiedenen Regionen gesehen, dass wir auf einem wahren „Datenschatz“ sitzen und haben nach einer Möglichkeit gesucht, diese Daten entsprechend auswerten zu können. Das ist damals um 2009/2010 um die H1N1 Pandemie herum entstanden. Ein weiterer Ausgangspunkt war auch RSV und die schwierige Fragen, wann die RSV-Saison beginnt, da man eine Prophylaxe für Frühgeborene hatte, die man richtig timen musste. Dafür brauchten wir Daten und habe und deswegen zusammengeschlossen, um diese Daten gemeinsam zu erfassen und auszuwerten.
CVN: Warum halten Sie das CVN für wichtig – z. B. für die Forschung, die öffentliche Gesundheit oder die wissenschaftliche Gemeinschaft?
Prof. Gärtner: Wir können mit den Daten viele Informationslücken schließen. Zu machen Erregern gibt es Meldepflichten, zu anderen nicht. Wir erfassen auch Erreger, für die es keine Meldepflicht gibt. Meldepflichten führen immer dazu, dass nur positive Befunde erfasst werden, man also nicht weiß, ob der Anstieg der Zahlen auf einen Anstieg der Fälle zurück geht oder einfach nur auf einen vermehrte Diagnostik. Im Netzwerk erfassen wir sowohl positive wie auch negative Befunde, damit können wir eine Positivitätsrate angeben und Artefakte durch vermehrte Diagnostik besser erkennen. Die Meldepflicht kann das nicht.
CVN: Welche Lücke schließt das CVN aus Ihrer Sicht im Vergleich zu bestehenden Surveillance-Systemen?
Prof. Gärtner: Für viele Erreger haben wir keine Surveillance, über das Netzwerk bekommen wir aber trotzdem diese Daten. Das gilt für viele respiratorische und gastrointestinale Erreger, von denen die wenigsten einer Meldepflicht unterliegen.
Ein weiteres Beispiel wären Clostridioides difficile (C. diff). Dafür gibt es eine komplexe Meldepflicht, die aber viele Fälle ausschließt. Über die Meldepflicht bekommen wir nur eine Absolutzahl von schweren Fällen, haben aber keine Information zur Positivitätsrate oder einfach zur gesamten Nachweisrate (auch leichte Fälle).
Das RKI unterhält bei respiratorischen Erregern mit der AGI (Arbeitsgemeinschaft Influenz) eine sehr gute Surveillance, testet aber nur um die 100 Proben /Woche und auch nur auf eine überschaubare Anzahl von viralen Infektionen. Das CVN kann hier ergänzen mit daten zu bakteriellen Infektionen, vielen anderen viralen Erregern und sehr viel mehr Proben, wenn auch die Erfassung der Proben bei der AGI systematischer ist. Im CVN können wir deswegen auch sehr gut Aussagen machen zu Interaktionen zwischen verschiedenen Erregern.
CVN: Welche zukünftigen Entwicklungen oder Erweiterungen können Sie sich für das Netzwerk vorstellen?
Prof. Gärtner: Im Augenblick werden respiratorische und gastrointestinale Erreger sehr gut erfasst. Es wäre vorstellbar auch andere Erreger wie Parvoviren, Masern, Mumps, Röteln oder auch seltene Erreger (reisemedizinisch relevante Erreger) zu erfassen, vielleicht auch Erreger die an sich nicht selten sind aber selten in bestimmten Materialen selten sind, z. B. Herpes simplex im Blut.
Zusammenfassung
Das Clinical Virology Network (CVN) entstand aus der Idee, Labordaten aus verschiedenen Regionen zu bündeln, um ein umfassenderes Bild über die Verbreitung von Infektionserregern zu gewinnen.
Wie Prof. Dr. Barbara Gärtner erläutert, schließt das Netzwerk wichtige Lücken bestehender Melde- und Surveillance-Systeme, da es auch negative Befunde erfasst und dadurch aussagekräftigere Positivitätsraten liefert.
Besonders bei respiratorischen und gastrointestinalen Erregern oder komplexen Fällen wie Clostridioides difficile ermöglicht das CVN differenzierte Analysen jenseits der reinen Fallzahlen.
Durch die Zusammenarbeit vieler Labore entsteht eine wertvolle Datengrundlage, die Forschung, Prävention und öffentliche Gesundheit gleichermaßen stärkt.